Bayern-Fans wird gern die Leidensfähigkeit abgesprochen. Was haben sie auch schon groß zu leiden. Sie gewinnen ja eh meistens. Und jede Niederlage ist nur ein kleiner Knick in der Matrix, der dann in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren mit Siegen, Pokalen und Triumphen ausgebessert wird. Es ist ein Leben auf der Sonnenseite der Fußballwelt. Ein einfaches und erfolgsverwöhntes Dasein. Ohne die Erfahrungen aus einem Abstiegskampf. So eine/r weiß doch gar nicht was Leiden wirklich heißt.
Dachte ich. Bis ich den Text von Patrick Völkner (Kommentar der Woche, spox und Blogspot360-Moderator) las. Er ist von ganzem Herzen Bayern-Fan und der Weg zum Triumph von London wurde für ihn zu einer stillen Qual. Immerhin – ich kann das hier wohl vorwegnehmen – mit Happy End:
Den schönsten (Fußball-)Tag des Jahres auf den 25. Mai zu datieren, zeugt wahrscheinlich nicht von großer Originalität. Jedenfalls wenn man Bayern-Fan ist. Doch das Champions-League-Finale ist und bleibt mein persönliches Highlight des Fußballjahres 2013. Was wohl auch damit zu tun haben konnte, dass es gewonnen wurde – im Gegensatz zu den Endspielen 2010 und 2012. Bayern-Fans eilt gemeinhin der Ruf voraus, gleichsam verwöhnt und unersättlich zu sein. Dem wird man angesichts der Titelbilanz und des allseits kundgetanen Erfolgsanspruchs wohl kaum widersprechen können. Ob das Selbstbewusstsein aber so ausgeprägt ist, dass man Siege als selbstverständlich erachtet und sich ihrer kaum mehr erfreuen kann, möchte ich bezweifeln. In meinem Falle passt das Stigma jedenfalls nicht.
Von Siegesgewissheit war bei mir im Vorfeld des Finales von London denn auch keine Spur. Nach der ernüchternden Pleite im Finale dahoam hatte ich die Hoffnung auf einen erneuten Gewinn der Königsklasse im Grunde aufgegeben und ärgerte mich in der Folge insgeheim fast ein wenig über jedes gewonnene Spiel in der Champions League. Frei nach dem Motto „Es wird am Ende doch eh nichts“. Jeder Sieg erhöhte nach meinem Verständnis nur die Wahrscheinlichkeit auf eine weitere frustrierende Finalniederlage, auf die ich gut und gerne verzichten konnte. „Lieber im Viertelfinale ausscheiden, als das Wagnis eines finalen Knock-Outs einzugehen“. Die Feigheit hatte von mir Besitz ergriffen.
Der Gedanke an das ultimative Scheitern im Finale hätte mich also über ein vorzeitiges Ausscheiden hinweggetröstet. Doch es kam bekanntlich anders. Arsenal, Turin, Barcelona – jeweils mehr oder weniger souverän aus dem Weg geräumt. So hieß es wieder einmal Finale. Nicht dahoam, sondern dadrüben – aber eben wieder Finale. Vize-Gefahr inklusive. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen, fürchtete ich doch, das emotionale Nirwana des Vorjahres erneut durchleben zu müssen. Von „mia san mia“ und bajuwarischer Zuversicht keine Spur. Im Grunde unwürdig für einen Bayern-Fan.
Von großer Vorfreude konnte denn auch keine Rede sein. Aber dem Spiel mit Gleichgültigkeit zu begegnen, wollte mir auch nicht gelingen. So begriff ich das Champions-League-Finale dieses Jahr als eine persönliche Herausforderung, eine Aufgabe, der ich mich stellen wusste. Wie auch immer es ausgehen würde.
Nun wollte es das Schicksal so, dass an jenem 25. Mai auch der Abschlussabend meiner Tipp- und Managergemeinschaft stattfand, eine skurrile Ansammlung selbsternannter Fußballexperten unter dem glorreichen und vielsagenden Namen „Tasmania Hackentrick“. Das Spiel der Spiele in Gesellschaft einer grölenden Clique, die für die emotionalen Befindlichkeiten eines Final-Burnout-geschädigten Bayern-Fans so gar nichts über hatte und im Fall der Fälle den üblichen Kübel Spott und Häme über mich ausgeschüttet hätte. Na Mahlzeit.
Das Elend wurde noch schlimmer. Selbst die an sich neutralen Tasmanen hatten sich vorab ein BVB- Trikot besorgt, um „die Brisanz ein wenig zu erhöhen“. Nun denn, ich hätte mich ihrer Attacken im Falle einer Niederlage wohl kaum erwehren können. Und so entschied mich zu einer ungewohnten Maßnahme: Ein Bayern-Spiel in Duckmäuser-Haltung und Demut verfolgen. Ohne große Töne, ohne selbstbewusste Siegesparolen – einfach nur still wollte ich es über mich ergehen lassen.
Und so geschah das, was mir in einem Vierteljahrhundert bis dahin noch nie gelungen war: Ein Bayern-Spiel über 90 Minuten schweigend zu verfolgen – unter Verzicht auf Schimpftiraden, Jubel und Ärger. Was nach einer provokativen Inszenierung aussah, war jedoch nur Ausdruck meiner Gefühlswelt. Ich schaute das Spiel nicht, ich durchlitt es.
Noch schlimmer wurde die Finalqual durch die Tatsache, dass wir das Spiel über einen Internet-Stream verfolgten. Mit der Folge einer fast einmütigen Verzögerung. Was ich sah, war – wie der Blick in die Sterne – stets nur eine Schau in die Vergangenheit. So absurd das Szenario auch war, vermochte es mich doch ein wenig zu beruhigen. „Was regst du dich auf: Das was du siehst, ist doch Schnee von gestern oder einer Minute. Spar dir das Mitfiebern – nützt eh nichts“.
Natürlich hielt das Mantra nicht lange. Meine Aufregung konnte ich nicht verhehlen. Und auch meine stoische Schweigehaltung vermochte wohl nicht darüber hinwegzutäuschen, dass ich während der 90 Minuten so angespannt war wie wohl noch nie zuvor im Angesicht eines Fußballspiels. So litt ich also in meiner Stille vor mich hin. Wortlos, und nach außen emotionslos. Fast, denn ein nölendes „Nein“ rutschte mir doch dann und wann schon heraus.
Als Mandzukic zum 1:0 traf, reichte es sogar zu einem verschämten „Ja“, auf das aber dann wieder die bekannte Stille folgte. Den Ausgleich der Dortmunder nahm ich kopfschüttelnd hin. Und wortlos versteht sich. Das Leiden wurde größer und unerträglicher – bis Arjen Robben schließlich die Kugel zum 2:1 ins Tor murmelte. Ein fast schon enthusiastisches „Yeeees“ entwich mir. Weitere emotionale Regungen verkniff ich mir in den folgenden vier Minuten: Ich verbarg meinem Kopf hinter meinem Bayern-Schal und stellte mich der finalen Qual.
Irgendwann, drei Nervenzusammenbrüche später, pfiff der Schiedsrichter ab. Gewonnen! „Schön“, dachte ich mir, „nicht noch mal so eine Pleite wie im Vorjahr“. Dass man nicht verloren hatte, schien mir im ersten Moment wichtiger als der Sieg. Doch im nächsten Augenblick begriff auch ich, dass man nicht nur eine Niederlage vermieden, sondern einen Titel gewonnen hatte, und schrie das in den 90 Minuten der Stille angestaute Adrenalin mit unkoordinierten „Yeees“-„Jaaaa“- und „Jawoll“-Rufen aus mir heraus.
Die Stille hatte ein Ende. Was blieb, war große Freude, Zufriedenheit und eine Erkenntnis: Fußball ist eine furchtbare Qual – die schönste, die es gibt.
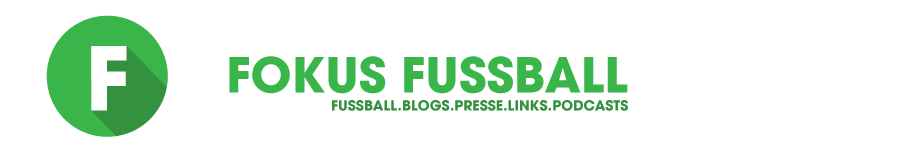

Pingback: Tor 24: Bescherung | Fokus Fussball